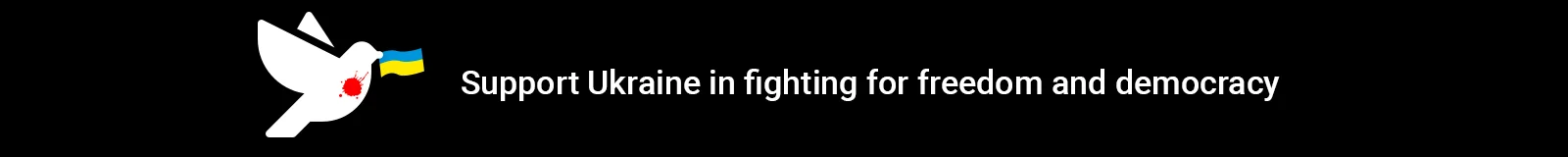Europäische Wanderheuschrecke
1 Spezies
Die Europäische Wanderheuschrecke (Locusta migratoria) ist eine Heuschrecke aus der Familie der Feldheuschrecken (Acrididae). Sie ist, wie die anderen Wanderheuschrecken, vom Altertum bis heute ein gefürchteter landwirtschaftlicher Schädling, der in Afrika, Vorder- und Ostasien Schäden in Millionenhöhe verursacht. Die Art kommt im mediterranen Südeuropa vor, ist aber hier heute ökonomisch bedeutungslos. Von seltenen einfliegenden Einzeltieren abgesehen kommt die Art heute nicht mehr in Mitteleuropa vor; ihr früheres, dauerhaftes Vorkommen (abseits einfliegender Schwärme) ist umstritten.
Es handelt sich um eine recht euryöke Art, wie sich schon aus dem riesigen, mehrere Kontinente umspannenden Verbreitungsgebiet ergibt. Die Art ist aber in Ei- und Larvalphase feuchtebedürftig und kommt nur in bodenfeuchten Lebensräumen vor. Vorzugshabitate sind offene, unbewaldete, oft sandige Auen und Uferzonen von Gewässern, insbesondere die breiten, nur zeitweise wasserführenden Talungen von unregulierten Wildflusslandschaften und Flussdeltas bieten optimale Bedingungen. In den feuchten Tropen kommt sie auch in sekundären Grasländern (nach Waldrodung) zur Entwicklung. Sie geht auch in gewissem Ausmaß auf entsprechendes Kulturland über, so wurde sie in der algerischen Sahara erst mit Bewässerungskulturen ansässig; in der Regel verschwindet sie aber bei intensiverer Landbewirtschaftung. Die Art ist, besonders im Eistadium, recht frosttolerant, Imagines sind aber bei Exposition von Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht lange lebensfähig. Die Nordgrenze der Verbreitung in Asien korreliert etwa mit der südlichen Grenze der Taiga-Zone, wobei nördlich und südlich verbreitete Populationen stark unterschiedliche Kältetoleranz zeigen.
Die Art ernährt sich bevorzugt von Gräsern, nimmt aber bei Nahrungsmangel eine Vielzahl anderer Pflanzen an. Sie fressen dann an anderen Monokotyledonen, an zweikeimblättrigen Pflanzen nur als Notnahrung, wenn nichts anderes zur Verfügung steht. Eine verbreitete Nahrungspflanze der solitären Form ist insbesondere Schilfrohr (Phragmites australis).
Die Europäische Wanderheuschrecke besiedelt ganz Afrika einschließlich der Insel Madagaskar, Süd- und Südosteuropa und fast ganz Asien südlich der borealen Nadelwaldzone. Im Osten erreicht sie die Insel Kunashir (Kurilen). Sie kommt über die südostasiatischen Inselketten bis nach Australien und Neuseeland vor.
In Europa tritt die Art in allen Ländern am Mittelmeer auf. Die Nordgrenze der Verbreitung liegt an den Südalpen, sie erreicht im Kanton Tessin die Schweiz. Früher bestehende Populationen am Vorderrhein und im Rhonetal (Wallis) sind mit der Flussregulation und der damit verbundenen Zerstörung der Auenlandschaft heute erloschen. In Mittel- und Nordeuropa wird die Art seit ca. 1950 kaum noch beobachtet, obwohl gelegentlich Einzeltiere gemeldet werden.
In Deutschland wurden einfliegende Schwärme in den Chroniken seit dem Mittelalter vermeldet; die Art hat bei den Chronisten schon deshalb besondere Aufmerksamkeit gefunden, weil sie zu den biblischen Plagen gehörte. In den Xantener Annalen aus dem 9. Jahrhundert n. Chr. heißt es beispielsweise: „Im Jahr der göttlichen Menschwerdung 873 verwüstete eine unermessliche Menge von Heuschrecken, die im Monat August von Osten her erschien, fast ganz Gallien. Sie waren größer als andere Heuschrecken und hatten sechs Flügelpaare.“ Zumindest die Anzahl der Flügelpaare ist definitiv als falsche Beobachtung anzusehen. Die beobachteten Schwärme zogen vor allem entlang der Flusstäler von Donau, Elbe und Oder, als Herkunftsgebiet wird das Donaudelta und die Steppenregion zwischen der Donau- und der Dnepr-Mündung am Schwarzen Meer vermutet. Der letzte Fund eines Einzeltiers auf deutschem Boden stammt aus dem Jahr 1949. Ob sich die Art jemals in Deutschland reproduzieren konnte, ist dabei nicht mehr nachvollziehbar. Ebenfalls liegen keine Erkenntnisse über Populationen in Baden-Württemberg vor, das an bekannte Populationen in Frankreich und der Schweiz grenzt. Letzte Funde von dort stammen aus dem Oberrheintal bei Freiburg im Breisgau 1846 sowie mehrfache Funde im Landkreis Karlsruhe 1847 und dem Mittleren Neckarraum (Stuttgart-Hohenheim) 1859.
Die Europäische Wanderheuschrecke (Locusta migratoria) ist eine Heuschrecke aus der Familie der Feldheuschrecken (Acrididae). Sie ist, wie die anderen Wanderheuschrecken, vom Altertum bis heute ein gefürchteter landwirtschaftlicher Schädling, der in Afrika, Vorder- und Ostasien Schäden in Millionenhöhe verursacht. Die Art kommt im mediterranen Südeuropa vor, ist aber hier heute ökonomisch bedeutungslos. Von seltenen einfliegenden Einzeltieren abgesehen kommt die Art heute nicht mehr in Mitteleuropa vor; ihr früheres, dauerhaftes Vorkommen (abseits einfliegender Schwärme) ist umstritten.
Es handelt sich um eine recht euryöke Art, wie sich schon aus dem riesigen, mehrere Kontinente umspannenden Verbreitungsgebiet ergibt. Die Art ist aber in Ei- und Larvalphase feuchtebedürftig und kommt nur in bodenfeuchten Lebensräumen vor. Vorzugshabitate sind offene, unbewaldete, oft sandige Auen und Uferzonen von Gewässern, insbesondere die breiten, nur zeitweise wasserführenden Talungen von unregulierten Wildflusslandschaften und Flussdeltas bieten optimale Bedingungen. In den feuchten Tropen kommt sie auch in sekundären Grasländern (nach Waldrodung) zur Entwicklung. Sie geht auch in gewissem Ausmaß auf entsprechendes Kulturland über, so wurde sie in der algerischen Sahara erst mit Bewässerungskulturen ansässig; in der Regel verschwindet sie aber bei intensiverer Landbewirtschaftung. Die Art ist, besonders im Eistadium, recht frosttolerant, Imagines sind aber bei Exposition von Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht lange lebensfähig. Die Nordgrenze der Verbreitung in Asien korreliert etwa mit der südlichen Grenze der Taiga-Zone, wobei nördlich und südlich verbreitete Populationen stark unterschiedliche Kältetoleranz zeigen.
Die Art ernährt sich bevorzugt von Gräsern, nimmt aber bei Nahrungsmangel eine Vielzahl anderer Pflanzen an. Sie fressen dann an anderen Monokotyledonen, an zweikeimblättrigen Pflanzen nur als Notnahrung, wenn nichts anderes zur Verfügung steht. Eine verbreitete Nahrungspflanze der solitären Form ist insbesondere Schilfrohr (Phragmites australis).
Die Europäische Wanderheuschrecke besiedelt ganz Afrika einschließlich der Insel Madagaskar, Süd- und Südosteuropa und fast ganz Asien südlich der borealen Nadelwaldzone. Im Osten erreicht sie die Insel Kunashir (Kurilen). Sie kommt über die südostasiatischen Inselketten bis nach Australien und Neuseeland vor.
In Europa tritt die Art in allen Ländern am Mittelmeer auf. Die Nordgrenze der Verbreitung liegt an den Südalpen, sie erreicht im Kanton Tessin die Schweiz. Früher bestehende Populationen am Vorderrhein und im Rhonetal (Wallis) sind mit der Flussregulation und der damit verbundenen Zerstörung der Auenlandschaft heute erloschen. In Mittel- und Nordeuropa wird die Art seit ca. 1950 kaum noch beobachtet, obwohl gelegentlich Einzeltiere gemeldet werden.
In Deutschland wurden einfliegende Schwärme in den Chroniken seit dem Mittelalter vermeldet; die Art hat bei den Chronisten schon deshalb besondere Aufmerksamkeit gefunden, weil sie zu den biblischen Plagen gehörte. In den Xantener Annalen aus dem 9. Jahrhundert n. Chr. heißt es beispielsweise: „Im Jahr der göttlichen Menschwerdung 873 verwüstete eine unermessliche Menge von Heuschrecken, die im Monat August von Osten her erschien, fast ganz Gallien. Sie waren größer als andere Heuschrecken und hatten sechs Flügelpaare.“ Zumindest die Anzahl der Flügelpaare ist definitiv als falsche Beobachtung anzusehen. Die beobachteten Schwärme zogen vor allem entlang der Flusstäler von Donau, Elbe und Oder, als Herkunftsgebiet wird das Donaudelta und die Steppenregion zwischen der Donau- und der Dnepr-Mündung am Schwarzen Meer vermutet. Der letzte Fund eines Einzeltiers auf deutschem Boden stammt aus dem Jahr 1949. Ob sich die Art jemals in Deutschland reproduzieren konnte, ist dabei nicht mehr nachvollziehbar. Ebenfalls liegen keine Erkenntnisse über Populationen in Baden-Württemberg vor, das an bekannte Populationen in Frankreich und der Schweiz grenzt. Letzte Funde von dort stammen aus dem Oberrheintal bei Freiburg im Breisgau 1846 sowie mehrfache Funde im Landkreis Karlsruhe 1847 und dem Mittleren Neckarraum (Stuttgart-Hohenheim) 1859.