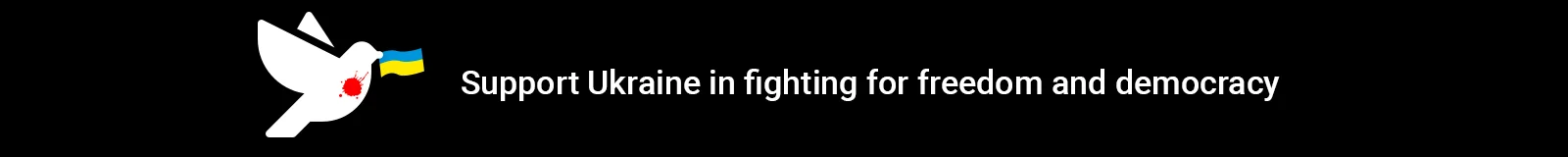



Die Varroamilbe (Varroa destructor) ist eine (als adultes Weibchen) ca. 1,1 Millimeter lange und 1,6 Millimeter breite Milbe aus der Familie Varroidae, die als Parasit an Honigbienen (Apis mellifera und Apis cerana) lebt. Die Milbe entwickelt und vermehrt sich in der verdeckelten Brut im Bienenstock. Der Befall von Bienenvölkern durch die Milbenart wird als Varroose (alter Name: Varroatose) bezeichnet. Varroa destructor gilt als der bedeutsamste Bienenschädling weltweit.
In Österreich ist die Tierseuche Varroose anzeigepflichtig, in der Schweiz unter Gr. 4 Zu überwachende Seuchen (Meldepflicht) eingestuft. In Deutschland ist sie in § 15 der Bienenseuchen-Verordnung zwar geregelt, aufgrund ihrer Ubiquität wird aber von einer Anzeige- oder Meldepflicht abgesehen.
Die weltweit am weitesten verbreiteten Methoden zur Bekämpfung dieses Parasiten basieren auf der Verwendung organischer Säuren wie Ameisen- oder Oxalsäure.
Die Gattung ist nach dem römischen Gelehrten Marcus Terentius Varro (116–27 v. Chr.) benannt, der Schriften über die Landwirtschaft verfasste.
Die Art ist durch einen markanten Sexualdimorphismus ausgezeichnet. Die Männchen sind erheblich kleiner und schmaler, von eher dreieckig-tropfenförmiger Gestalt, ihre Beine sind im Verhältnis zur Körpergröße deutlich länger. Sie sind schwächer sklerotisiert und hellgelb. 80 % aller Varroamilben sind weiblich, nur sie verlassen die Brutwabe und treten damit in Erscheinung, während die Männchen nach der Begattung dort verbleiben und sterben.
Wie bei den meisten Milben ist der Körper der Varroamilbe in zwei Abschnitte geteilt, die Idiosoma und Gnathosoma genannt werden. Das Gnathosoma, an dem die Mundwerkzeuge sitzen, ist relativ klein und auf die Bauchseite zwischen die Hüften (Coxen) des ersten Beinpaars verlagert, es ist bei Betrachtung von oben nicht sichtbar. Das Idiosoma ist auf der Rückenseite von einem ungeteilten, stark sklerotisierten Schild bedeckt, der rotbraun ist. Auf der Bauchseite sitzen mehrere ebenfalls rotbraune Ventralschilde, die durch Nähte miteinander verbunden sind. Der Rückenschild des Weibchens ist queroval und deutlich breiter als lang, er ist dicht mit Borsten (Setae) bedeckt. Die Mundwerkzeuge bestehen aus zwei als Sinnesorgane dienenden Pedipalpen und zwei dreigliedrigen Cheliceren, die der Nahrungsaufnahme dienen. Das letzte Chelicerenglied ist als beweglicher, gezähnter Chelicerenfinger ausgebildet, mit ihm kann die Milbe die Körperwand ihrer Wirtsbiene aufschneiden. Der zweite, unbewegliche Chelicerenfinger fehlt (Familienmerkmal). Die Milbe besitzt vier Beinpaare, deren erstes sechsgliedrig ist, die übrigen sind siebengliedrig. Die kurzen, kräftigen Beine tragen keine Klauen, stattdessen sitzen auf der Oberfläche als Apotelen bezeichnete Strukturen, die zum Festhalten dienen. Das nach vorn gestreckte erste Beinpaar dient als Sinnesorgan. Es trägt neben verschiedenen Sinneshaaren, die als Mechano- und Chemorezeptoren dienen, ein grubenartiges Sinnesorgan, ähnlich dem Haller-Organ der Zecken.
Auf der Bauchseite des Idiosomas sitzt eine langgestreckte Einsenkung, das Peritrema. Diese ist mit den Stigmen des Tracheensystems verbunden, die auf der Bauchseite außen sitzen, und dient als Atemorgan.






Die Art ist in allen Lebensstadien parasitisch und kommt niemals frei lebend, sondern ausschließlich im Inneren von Bienenstöcken, oder auf Bienen, vor. Alle Nymphenstadien und die Männchen leben im Inneren von verdeckelten Brutzellen. Nur die Weibchen kommen auch außerhalb der Zellen vor. Sie sitzen dann normalerweise an der Bauchseite des Hinterleibs von erwachsenen Bienen, meist in die Intersegmentalhaut zwischen den Bauchschilden eingebohrt, können aber auch andernorts am Körper sitzen. Gegen das Putzverhalten der Bienen sind sie durch den festen Rückenschild gut geschützt. Die Übertragung der Varroamilbe auf weitere Bienenvölker ist natürlicherweise nur bei direktem Körperkontakt durch fehlorientierte oder nahrungsraubende Arbeiterinnen in fremden Stöcken möglich. Die adulten Varroa-Weibchen saugen zur Nahrungsaufnahme an den Arbeiterinnen, für ihre Vermehrung sind sie aber an die Brutwaben des Bienenstockes gebunden.
Die Varroa-Weibchen verlassen die adulte Biene, während diese eine Brutzelle mit einer verpuppungsbereiten Altlarve (fünftes Larvenstadium) verdeckelt. Obwohl verschiedene Chemorezeptoren und aus Verhaltensexperimenten eine anlockende Wirkung von Bienenlarven, Kokonmaterial und Nahrungsvorräten auf die Milbe bekannt sind, wird der auslösende Reiz noch nicht im Detail verstanden. Brut von Drohnen wird bis zu achtmal stärker befallen als die von Arbeiterinnen, Königinnenbrut jedoch so gut wie nie. Die Milbe wandert durch den Zwischenraum zwischen der Bienenlarve und der Zellenwand zum Zellenboden, der den restlichen Nahrungsvorrat enthält, möglicherweise, um Abwehrverhalten der Bienen zu entgehen. Die Milbe beginnt an der Bienenlarve zu saugen, wenn der Nahrungsvorrat aufgebraucht ist. Sie legt etwa 50 Stunden nach der Verdeckelung ihr erstes Ei ab. Dieses bleibt unbefruchtet und entwickelt sich aufgrund der Geschlechtsbestimmung über Haplodiploidie zu einem Varroa-Männchen. Die folgenden Eier, die mit etwa 30 Stunden Abstand gelegt werden, werden befruchtet und entwickeln sich daher zu Weibchen. Eine Muttermilbe legt bei Arbeiterinnenlarven fünf, bei Drohnenlarven sechs weibliche Eier ab.
Das erste Entwicklungsstadium der Varroa ist eine sechsbeinige Larve, die sich vollständig innerhalb der Eischale entwickelt. Daraus entsteht im zweiten Entwicklungsstadium eine achtbeinige Protonymphe, die aus dem Ei schlüpft. Sie häutet sich zum dritten Entwicklungsstadium, der Deutonymphe, aus der die neue Generation adulter Milben hervorgeht. Beide Nymphenstadien werden gegen Ende ihrer Wachstumsperiode unbeweglich, dieses immobile Übergangsstadium wird als Chrysalis bezeichnet. Während die Nymphen weiß sind, besitzt das letzte Ruhestadium (Deutochrysalis) bereits die braune Farbe der adulten Milbenweibchen.
Weder Nymphen noch Männchen der Varroamilbe sind zur unabhängigen Nahrungsaufnahme fähig, denn ihre Mundwerkzeuge können das Integument der Bienenlarve nicht durchdringen; beim Männchen sind diese zu spezialisierten Begattungsorganen umgebildet und für die Nahrungsgewinnung nicht verwendbar. Sie sind darauf angewiesen, dass die Muttermilbe der Bienenlarve oder -puppe Wunden beibringt, an denen sie saugen können. Diese liegen normalerweise am fünften Segment der Wirtsbiene.
Die Milbenweibchen werden unmittelbar nach der Häutung zum Adulttier geschlechtsreif. Die Geschwister paaren sich in den Tagen, bevor die Biene schlüpft, mehrere Male untereinander. Das Männchen begattet die Weibchen im Inneren der noch verdeckelten Brutzelle, indem es eine Spermatophore direkt in die Gonophore des Weibchens überträgt, welche sie in einer Spermatheca speichert, um die weiteren Eier damit befruchten zu können. Das Männchen stirbt anschließend, ohne die Zelle je zu verlassen. Die Milbenweibchen verlassen die Zelle zusammen mit der schlüpfenden Biene nach etwa 12 Tagen, während das Männchen zurückbleibt. Das Muttertier kann die Zelle ebenfalls für einen zweiten, seltener sogar einen dritten solchen Fortpflanzungszyklus, wieder verlassen. Trotz der relativ moderaten Fortpflanzungsrate und einem nicht unerheblichen Anteil von Milben, die sich aus unbekannten Gründen gar nicht fortpflanzen, kollabieren Bienenvölker unter gemäßigten Klimabedingungen etwa drei bis vier Jahre nach der Infektion mit Varroa destructor. In wärmerem, subtropischem oder tropischem Klima wächst die Milbenpopulation dagegen langsamer.