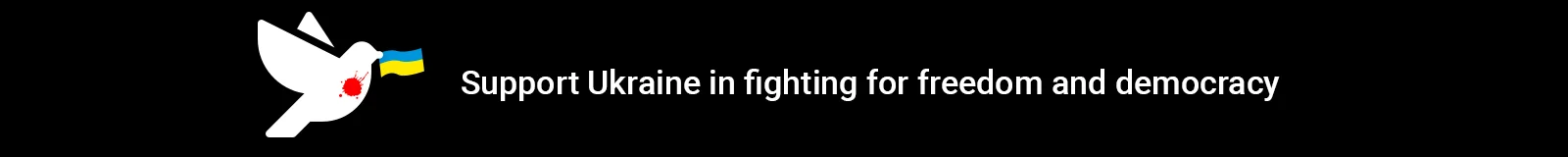



Europäische wanderheuschrecke
Die Europäische Wanderheuschrecke (Locusta migratoria) ist eine Heuschrecke aus der Familie der Feldheuschrecken (Acrididae). Sie ist, wie die anderen Wanderheuschrecken, vom Altertum bis heute ein gefürchteter landwirtschaftlicher Schädling, der in Afrika, Vorder- und Ostasien Schäden in Millionenhöhe verursacht. Die Art kommt im mediterranen Südeuropa vor, ist aber hier heute ökonomisch bedeutungslos. Von seltenen einfliegenden Einzeltieren abgesehen kommt die Art heute nicht mehr in Mitteleuropa vor; ihr früheres, dauerhaftes Vorkommen (abseits einfliegender Schwärme) ist umstritten.
Te
TerrestrischTerrestrische Tiere sind Tiere, die überwiegend oder vollständig an Land leben (z.B. Katzen, Ameisen, Schnecken), im Gegensatz zu aquatischen Tiere...
Ov
OviparieAls ovipar bezeichnet man Tiere, die Eier legen. Der Oviparie steht die Viviparie gegenüber. Die Vertreter beider Fortpflanzungsformen stellen kein...
M
beginnt mitEs handelt sich um eine große Feldheuschrecke, Männchen erreichen etwa 33 bis 51 Millimeter, die etwas größeren Weibchen 39 bis 55 Millimeter Körperlänge. Die Vorderflügel (Tegmina) sind sehr lang, sie überragen weit die Spitze des Hinterleibs, sie sind grob doppelt so lang wie die Hinterschenkel, beim Männchen maximal etwa 56, beim Weibchen 61 Millimeter lang. Der Kopf besitzt eine im Profil etwa rechteckige Gestalt, die Frons ist also vertikal. Die Stirngrübchen sind undeutlich, etwa dreieckig und grenzen direkt an die Augen an. Die Mandibeln sind bläulich gefärbt. Das Pronotum besitzt einen deutlichen Mittelkiel, der in der Mitte durch eine Querfurche eingekerbt ist, Seitenkiele fehlen. In Aufsicht ist sein Hinterrand dreieckig nach hinten vorgezogen. Der Thorax ist auf der Bauchseite von einer feinen Behaarung bedeckt. Auf der Oberseite der Hinterschenkel (Femora) sitzt oben eine Reihe kleiner spitzer Dörnchen. Die langen Sprungbeine dienen nicht nur der Fortbewegung, sondern auch der Abwehr von Artgenossen, die während der Nahrungsaufnahme zu nahe kommen. Mit rückwärts gerichteten Tritten werden sie auf Abstand gehalten. Dabei kommen auch die Dornen zum Einsatz. Die Hinterflügel sind klar (hyalin) ohne Färbung oder Bänderung.
Die Art tritt in zwei Phasen auf, einer solitären Phase, die im Habitat verbleibt und einzeln lebt, und einer gregären Phase, die sich zu großen, wandernden Schwärmen zusammenschließt. Diese sind meist an der Färbung, sonst an einigen morphologischen Merkmalen unterscheidbar. Es gibt allerdings Übergangsformen zwischen den Phasen (sog. transiens-Phase), die nicht eindeutig zuzuordnen sind. Die Individuen der solitären Phase sind meist überwiegend grün gefärbt mit dunkler Fleckenzeichnung, es kommen aber auch braune Individuen vor. Die Hinterschienen sind meist rot oder rötlich. Das Pronotum ist bei Ansicht von der Seite kaum eingeschnürt, sein Mittelkiel ist hoch, in Seitenansicht bogenförmig, der Hinterrand ist rechtwinklig. Die Individuen der gregären Phase sind braun oder braungrau gefärbt, oft mit zwei schwarzen Längsstreifen auf dem Pronotum. Die Hinterschienen sind eher gelblich. Das Pronotum ist bei Ansicht von der Seite deutlich eingeschnürt, der Mittelkiel niedrig und gerade oder sogar etwas eingesenkt, der Hinterrand ist stumpfwinklig. Die Hinterflügel sind gegenüber der solitären Phase etwas länger.
Von der (nahe verwandten) Gattung Oedaleus ist die Europäische Wanderheuschrecke an der fehlenden Kreuzzeichnung auf dem Pronotum unterscheidbar (die dieser den Namen „Kreuzschrecken“ eingebracht hat), außerdem besitzt diese eine kontrastreiche Querbänderung der Vorderflügel. Von der Wüstenheuschrecke Schistocerca gregaria ist sie sicher an dem fehlenden zapfenförmigen Vorsprung zwischen den Vorderhüften unterscheidbar. Die in Südeuropa recht häufige Anacridium aegypticum ist leicht anhand von deren gestreiften Komplexaugen unterscheidbar.





Es handelt sich um eine recht euryöke Art, wie sich schon aus dem riesigen, mehrere Kontinente umspannenden Verbreitungsgebiet ergibt. Die Art ist aber in Ei- und Larvalphase feuchtebedürftig und kommt nur in bodenfeuchten Lebensräumen vor. Vorzugshabitate sind offene, unbewaldete, oft sandige Auen und Uferzonen von Gewässern, insbesondere die breiten, nur zeitweise wasserführenden Talungen von unregulierten Wildflusslandschaften und Flussdeltas bieten optimale Bedingungen. In den feuchten Tropen kommt sie auch in sekundären Grasländern (nach Waldrodung) zur Entwicklung. Sie geht auch in gewissem Ausmaß auf entsprechendes Kulturland über, so wurde sie in der algerischen Sahara erst mit Bewässerungskulturen ansässig; in der Regel verschwindet sie aber bei intensiverer Landbewirtschaftung. Die Art ist, besonders im Eistadium, recht frosttolerant, Imagines sind aber bei Exposition von Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht lange lebensfähig. Die Nordgrenze der Verbreitung in Asien korreliert etwa mit der südlichen Grenze der Taiga-Zone, wobei nördlich und südlich verbreitete Populationen stark unterschiedliche Kältetoleranz zeigen.
Die Art ernährt sich bevorzugt von Gräsern, nimmt aber bei Nahrungsmangel eine Vielzahl anderer Pflanzen an. Sie fressen dann an anderen Monokotyledonen, an zweikeimblättrigen Pflanzen nur als Notnahrung, wenn nichts anderes zur Verfügung steht. Eine verbreitete Nahrungspflanze der solitären Form ist insbesondere Schilfrohr (Phragmites australis).
Die Europäische Wanderheuschrecke besiedelt ganz Afrika einschließlich der Insel Madagaskar, Süd- und Südosteuropa und fast ganz Asien südlich der borealen Nadelwaldzone. Im Osten erreicht sie die Insel Kunashir (Kurilen). Sie kommt über die südostasiatischen Inselketten bis nach Australien und Neuseeland vor.
In Europa tritt die Art in allen Ländern am Mittelmeer auf. Die Nordgrenze der Verbreitung liegt an den Südalpen, sie erreicht im Kanton Tessin die Schweiz. Früher bestehende Populationen am Vorderrhein und im Rhonetal (Wallis) sind mit der Flussregulation und der damit verbundenen Zerstörung der Auenlandschaft heute erloschen. In Mittel- und Nordeuropa wird die Art seit ca. 1950 kaum noch beobachtet, obwohl gelegentlich Einzeltiere gemeldet werden.
In Deutschland wurden einfliegende Schwärme in den Chroniken seit dem Mittelalter vermeldet; die Art hat bei den Chronisten schon deshalb besondere Aufmerksamkeit gefunden, weil sie zu den biblischen Plagen gehörte. In den Xantener Annalen aus dem 9. Jahrhundert n. Chr. heißt es beispielsweise: „Im Jahr der göttlichen Menschwerdung 873 verwüstete eine unermessliche Menge von Heuschrecken, die im Monat August von Osten her erschien, fast ganz Gallien. Sie waren größer als andere Heuschrecken und hatten sechs Flügelpaare.“ Zumindest die Anzahl der Flügelpaare ist definitiv als falsche Beobachtung anzusehen. Die beobachteten Schwärme zogen vor allem entlang der Flusstäler von Donau, Elbe und Oder, als Herkunftsgebiet wird das Donaudelta und die Steppenregion zwischen der Donau- und der Dnepr-Mündung am Schwarzen Meer vermutet. Der letzte Fund eines Einzeltiers auf deutschem Boden stammt aus dem Jahr 1949. Ob sich die Art jemals in Deutschland reproduzieren konnte, ist dabei nicht mehr nachvollziehbar. Ebenfalls liegen keine Erkenntnisse über Populationen in Baden-Württemberg vor, das an bekannte Populationen in Frankreich und der Schweiz grenzt. Letzte Funde von dort stammen aus dem Oberrheintal bei Freiburg im Breisgau 1846 sowie mehrfache Funde im Landkreis Karlsruhe 1847 und dem Mittleren Neckarraum (Stuttgart-Hohenheim) 1859.

In den nördlicheren Teilen ihres Verbreitungsgebiets erreicht die Art eine Generation pro Jahr; in den Tropen können sich aber bis zu fünf Generationen im Jahr entwickeln, sie entwickelt sich hier ohne obligate Diapause; Imagines treten dann ganzjährig auf. Bereits in Nordafrika werden drei Generationen im Jahr erreicht. In winterkalten Klimaten überwintert die Art im Eistadium. Die Eier werden in von einer schaumartigen Substanz umhüllten Ootheken in den Boden abgelegt, jede Oothek enthält 50 bis 70 Eier. Zur erfolgreichen Entwicklung müssen sie Wasser aus dem umgebenden Boden aufnehmen, dies dauert etwa 10 bis 20 Tage. Die Erstlarven schlüpfen in den nördlichen Teilen des Verbreitungsgebiets etwa Mitte bis Ende Mai, in Nordafrika (Algerien) bereits im März. Die Art besitzt fünf Larvenstadien, die unter günstigen Bedingungen jeweils in fünf bis sechs Tagen durchlaufen werden, insgesamt ergeben sich so 35 bis 40 Tage Entwicklungszeit. Die Nymphen (im englischen Sprachraum hopper genannt) der gregären Phase schließen sich sofort nach dem Schlupf zu großen Schwärmen zusammen.
Wichtig bei der Aufzucht beziehungsweise Haltung von L. migratoria ist Wärme, gelegentliche UV-Bestrahlung und ausreichend Grünfutter. Sollte dieses nicht in ausreichenden Mengen vorhanden sein, empfiehlt es sich, schnellwachsenden Weizen zu ziehen. Gerne wird auch ein Stückchen Banane verzehrt. Für die Eiablage wird im Terrarium ein ca. 15 Zentimeter hoher Erdbereich (möglichst Sand) benötigt. Die Entwicklung vom Ei bis zur Larve dauert je nach Umgebungstemperatur ca. einen Monat.
