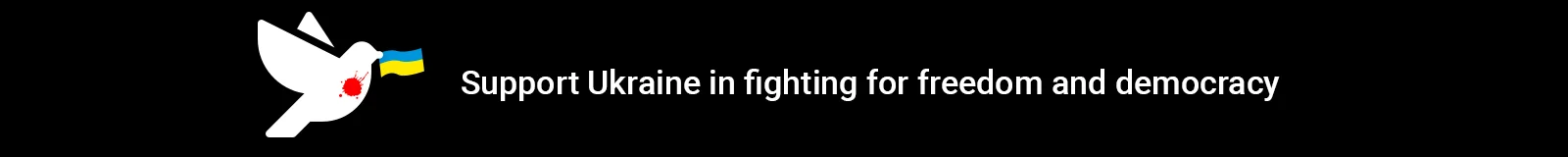



Kaiserhummer, Norwegischer hummer, Tiefseehummer, Schlanker hummer, Hummerkrabbe, Runenkrebs
Der Kaisergranat (Nephrops norvegicus), auch Kaiserhummer, Norwegischer Hummer, Tiefseehummer, Schlanker Hummer, Hummerkrabbe oder Runenkrebs genannt, ist ein im Kontinentalschelf des Nordostatlantiks, des Mittelmeers und der Nordsee lebender Zehnfußkrebs. Er besitzt einen hummerähnlichen Körperbau und kann Gesamtkörperlängen von über 20 Zentimetern sowie ein Alter von mehr als 10 Jahren erreichen. Kaisergranate halten sich überwiegend in 20 bis 800 Metern Meerestiefe in selbstgegrabenen Höhlen auf, die sie nur zur Fortpflanzung und meist einmal täglich zur Futtersuche verlassen. In ihrem gesamten Verbreitungsgebiet werden sie mehrheitlich mit Grundschleppnetzen befischt, weil vor allem ihr Hinterleib (Abdomen) als Delikatesse gilt. Trotz dieser intensiven Befischung ist der Kaisergranat nach Artenschutzkriterien nicht gefährdet, obgleich einige Bestände überfischt werden.
Aa
AasfresserAls Aasfresser oder Nekrophagen werden Tiere bezeichnet, deren Nahrung hauptsächlich oder teilweise aus Kadavern von Tieren besteht, die sie nicht ...
Ov
OviparieAls ovipar bezeichnet man Tiere, die Eier legen. Der Oviparie steht die Viviparie gegenüber. Die Vertreter beider Fortpflanzungsformen stellen kein...
N
beginnt mit




Der Kaisergranat ist im östlichen Nordatlantik, in der Nordsee und im westlichen und zentralen Mittelmeer verbreitet. Er lebt dort auf dem Kontinentalschelf bzw. Kontinentalhang in Tiefen von 20 bis 800 Metern. Sein Verbreitungsgebiet im Atlantik reicht im Norden von Island und Norwegen etwa bei den Lofoten bis Marokko im Süden. Im Mittelmeer reicht die Verbreitung bis etwa 25°O. Der Kaisergranat ist somit nicht im Levantischen Meer, in der Ostsee, im Schwarzen Meer oder auch am Bosporus heimisch. Das Vorkommen des Kaisergranats ist streng an die Beschaffenheit des Meeresbodens gebunden, weshalb sein Verbreitungsgebiet diskontinuierlich ist. In europäischen Gewässern sind mindestens 30 voneinander getrennte Populationen bekannt. Der Bestand des Kaisergranats gilt als stabil. In der Roten Liste der IUCN wird er deshalb als „nicht gefährdet“ (least concern) eingestuft.
Kaisergranate leben auf eher schlammigem Meeresgrund, der aus über 40 % Ton und Silt besteht. Sie graben sich Höhlen, die sie als Verstecke nutzen. Höhlengänge erstrecken sich 20 bis 30 Zentimeter unterhalb der Bodenoberfläche. Diese Höhlen sind meist U-förmig, mit einem Haupteingang und einem schmaleren, zweiten Eingang. Der Tunnel zwischen den Eingängen kann Längen von 50 bis 80 Zentimetern erreichen. Höhlen mit nur einem Eingang, sowie komplexe Höhlensysteme mit mehreren Eingängen sowie vertikalen Schächten werden seltener beobachtet. Die Zahl der Höhlen reicht von 0,1 bis 1,6 je Quadratmeter. Diese Dichte scheint abhängig von der Korngrößenverteilung des Bodens. So wurden beispielsweise in schottischen Gewässern bei sehr feinen Böden, also bei geringem Sandanteil, eher geringere Populationsdichten festgestellt.

Kaisergranate leben als Einzelgänger und halten sich hauptsächlich in ihren Höhlen auf. Diese werden meist nur sehr kurz für Nahrungssuche oder Fortpflanzung verlassen. Beobachtet wurden das Wechseln von sowie Kämpfe um Höhlen. Ritualisierte Kämpfe finden auch statt, um eine Rangordnung zwischen Individuen zu bestimmen. Kämpfe beinhalten stets Drohgebärden, bei der die großen Scheren horizontal abgespreizt werden sowie eine sehr aufrechte Körperhaltung eingenommen wird. Mit den Scheren versuchen Kombattanten den Gegner zu schlagen und wegzudrücken sowie Gliedmaßen zu ergreifen. Im Labor dauerten solche Kämpfe meist nicht länger als eine Minute, und bei keinem beobachteten Kampf kam es zu Verletzungen. Die Aufrechterhaltung der Rangordnung wird bei Kaisergranaten über Urinausscheidungen erreicht. Möglich ist, dass sich die Tiere am Uringeruch erkennen oder dass mit ihm der soziale Status vermittelt werden kann.
Das tägliche Verlassen der Höhle ist abhängig von der besiedelten Meerestiefe. In eher flachen Gewässern bis zu einer Tiefe von 40 Metern verlassen Kaisergranate ihre Höhle meist nur einmal in der Nacht. Bei mittleren Tiefen zwischen 40 und 100 Metern werden Höhlen in der Regel zweimal, bei Sonnenauf- und -untergang, verlassen. Bei größeren Tiefen verlassen Kaisergranate ihre Höhlen meist einmal tagsüber. Die Gründe für dieses Verhalten sind nicht vollständig geklärt. Neben exogenen Einflüssen wie der Lichtverfügbarkeit werden auch endogene Faktoren, etwa individuelle Aktivitätsrythmen, bei den Kaisergranaten vermutet.
Kaisergranate sind eher sesshaft. Sie migrieren nicht mehr als einige hundert Meter, sodass ein genetischer Austausch zwischen einzelnen Populationen nicht stattfindet. Dieser ist einzig während ihres planktischen Larvenstadiums denkbar, wenn größere Distanzen überwunden werden können.
Der Kaisergranat ist ein opportunistischer Prädator und Aasfresser. Die Zusammensetzung der Nahrung ist in erster Linie abhängig von Beuteverfügbarkeit und nicht von Ernährungspräferenzen, weshalb es zwischen Populationen des Kaisergranats zu Unterschieden in der Ernährung kommen kann. Den Hauptteil der Ernährung machen Krebstiere, Vielborster, Weichtiere und im geringen Maße auch Stachelhäuter aus. Kaisergranate sind wohl auch Filtrierer und somit in der Lage, Detritus oder Plankton aus dem Wasser zu filtern und als Nahrung zu nutzen. Dies könnte ein wichtiger Beitrag in der Ernährung von eiertragenden Weibchen sein, die monatelang ihre Höhle nicht verlassen. Kannibalismus ist nicht ungewöhnlich.
Ebenfalls nicht ungewöhnlich ist das Vorfinden von Sandkörnern oder Schlamm im Verdauungstrakt. Bei einer Untersuchung von Mageninhalten des Kaisergranats an der Westküste Schottlands, am Firth of Clyde, wurde in 83 % der gefangenen Exemplare Plastik, meist in Form von Fäden, gefunden. Diese könnten sowohl mit Sedimenten aufgenommen worden sein oder auch mit Beutetieren. Kaisergranate wurden außerdem beobachtet, wie sie Steine aufnehmen und sie mit Hilfe der Maxillipeden vor den Mandibeln und Maxillen bewegen. Zusätzlich könnte das Filtrieren des Wassers dazu beitragen, dass Plastik aufgenommen wird. Laut der Studie können sich zumindest einige der Plastikfäden im Verdauungstrack akkumulieren, da sie nicht ausgeschieden werden können.
Weibchen der Kaisergranate werden im Alter zwischen 2 und 3,5 Jahren geschlechtsreif. Sie besitzen dann in Abhängigkeit von Alter und geographischer Lage eine Carapaxlänge von 21 bis 36 Millimeter. Männchen sind bei Geschlechtsreife 3 Jahre alt, und ihre Carapaxlänge liegt zwischen 24 und 27 Millimetern.
Die Begattung erfolgt im Winter oder Frühling, kurz nachdem sich das Weibchen gehäutet hat. Die Befruchtung der Eier sowie das Laichen finden im Spätsommer bis Herbst statt. Die Zahl der Eier, die ein Weibchen ablaichen kann, ist abhängig von seiner Körpergröße. Bei einer Carapaxlänge von 25 Millimetern beträgt die Zahl der Eier 600 bis 1200; bei einer Carapaxlänge von 45 Millimetern können bis zu 4800 Oozyte gezählt werden. Nicht von der Körpergröße abhängig ist das Volumen eines Eies, das um 1,5 Kubikmillimeter beträgt. Das Weibchen befestigt die befruchteten Eier an ihren Pleopoden. Ab diesem Zeitpunkt verlässt ein eiertragendes Weibchen seine Höhle nicht mehr. Die Dauer der Inkubation, also die Zeit zwischen Laichen der Eier und Schlüpfen der Larven, ist stark abhängig von der Wassertemperatur. Sie beträgt etwa 5,5 Monate bei 15 °C und 10 Monate bei 8 °C. Weibchen in nördlichen Gewässern bei Island und Norwegen laichen deshalb nur alle zwei Jahre, während im übrigen Verbreitungsgebiet jährliches Laichen zu beobachten ist. Mit zunehmendem Alter des Weibchens kann es vorkommen, dass es auch im südlichen Verbreitungsgebiet nur noch alle zwei Jahre laicht. Die Farbe der Eier ist zunächst dunkelgrün, wird mit der Zeit heller und ist kurz vor dem Schlupf bräunlich-pink. Während der Inkubation können bis zu 75 % der Eier aufgrund von Prädation, Kannibalismus, unvollständiger Embryonalentwicklung sowie unzureichender Haftung an den Pleopoden verloren gehen. Das Schlüpfen der Larven erfolgt im späten Winter bis frühen Frühling, woraufhin sich das Weibchen häutet und eine erneute Begattung stattfinden kann.
Die frisch geschlüpften Zoealarven sind etwa 6,5 Millimeter lang. Sie sind im Gegensatz zu Adulten frei schwimmend und somit Teil der Planktons. Junge Kaisergranate durchlaufen drei Larvenstadien, bevor sie als Postlarve mit einer Körperlänge von etwa 16 Millimetern zu einer benthischen Lebensweise übergehen. Die Dauer der planktischen Phase ist abhängig von der Temperatur und kann von drei Wochen bei 15 °C bis sieben Wochen bei 8 °C reichen. Während ihres ersten Lebensjahrs verlassen Kaisergranate nur äußerst selten ihre Höhlen.
Im Vergleich zu anderen Zehnfußkrebsen sind nur wenige Ektoparasiten des Kaisergranats bekannt. Zu ihnen zählt Symbion pandora, eine Art der Cycliophora, die auf den Mundwerkzeugen von Kaisergranaten aus dem Kattegat gefunden wurde. Vom Rankenfußkrebs Balanus crenatus ist bekannt, dass er das Exoskelett befällt und meist auf älteren Exemplaren zu finden ist. Außerdem fand man an Pleopoden die Foraminiferengattung Cyclogyra. Auch besitzen Kaisergrante kaum Symptome der Schalenkrankheit, eine von Bakterien verursachte Degeneration des Exoskeletts bei Zehnfußkrebsen. Nur bei etwa 1 % der untersuchten Individuen auf italienischen Fischmärkten wiesen die typischen Läsionen auf. Bräunliche Nekrosen konnten allerdings an den Rändern von Verletzungen beobachtet werden, die wohl von Chitin abbauenden Bakterien verursacht wurden.
Ein systemischer Befall kann durch Wimpertierchen der Gattungen Mesanophrys bzw. Orchitophyra erfolgen. Der Verdauungstrakt von Kaisergranaten kann von der Gregarinenart Porospora nephropis und von einem Stadium des Saugwurms Stichocotyle nephropis befallen sein. Histriobdella homari, ein Vielborster der Eunicida, wird eher selten in den Atmungskammern der Wirtstiere beobachtet.
Arten der Gattung Hematodinium der Dinoflagellaten können Kaisergranate befallen, die dann abnormal lethargisches Verhalten zeigen und eine opake, gelblich-orange Färbung sowie milchig-weiße Hämolymphe vorweisen. Die Prävalenz des Befalls lag bei Schottland bei 10 bis 15 %, wobei diese wohl überschätzt wird, weil kranke Kaisergranate nicht nur schlechter schwimmen können, sondern auch sehr viel länger außerhalb ihrer Höhlen bleiben und somit im größeren Maße gefangen werden können als gesunde. Ein Befall mit Hematodinium führt unausweichlich, direkt oder indirekt zum Tod.
Eine idiopathische Muskelnekrose des Abdomens wurde bei von Trawlern gefangenen Kaisergranaten beobachtet. Bereits kurz nach dem Fang können sich zunächst Bereiche, später das gesamte Abdomen weißlich färben. Es ist dann langgestreckt und nicht mehr leicht gebogen. Die Ursache ist nicht vollständig geklärt. Man vermutet eine durch Stress induzierte, geringere Resistenz gegenüber Krankheitserregern in Verbindung mit Verletzungen, die durch ständiges Schwanzschlagen, der Fluchtreaktion von Hummerartigen, während des Fangprozesses verursacht werden können.