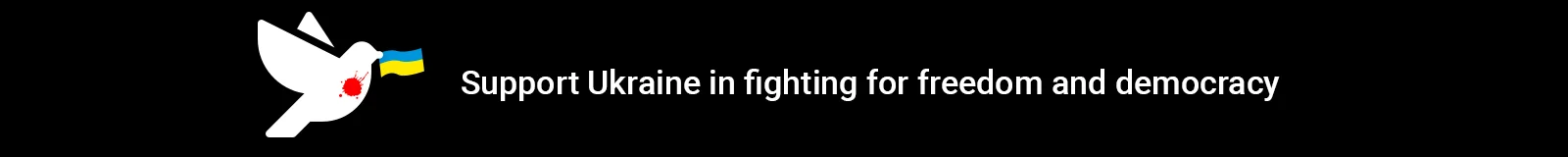



Warmhaus-riesenkrabbenspinne, Riesenkrabbenspinne
Die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne (Heteropoda venatoria), häufig vereinfachend auch nur Riesenkrabbenspinne genannt, ist eine Spinne aus der gleichnamigen Familie der Riesenkrabbenspinnen (Sparassidae). Die mit einer Beinspannweite von bis zu 120 Millimetern sehr große Spinnenart stammt wahrscheinlich aus den tropischen Bereichen Asiens, hat sich mittlerweile jedoch weltweit ausgebreitet. In eigentlich überlebensfeindlichen geografischen Gebieten bevorzugt die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne beheizte Gebäude menschlicher Siedlungsbereiche und hierbei insbesondere Warmhäuser, ein Umstand, auf den auch ihr erster Namensbestandteil zurückgeht.
Weil die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne mitunter Bananenplantagen bewohnt und deshalb an gehandelten Bananen gefunden werden kann, wird sie auch als „Bananenspinne“ bezeichnet. Diese Trivialbezeichnung hat sie mit einigen Arten der Gattung Cupiennius aus der Familie der Fischerspinnen (Trechaleidae) und auch mit Vertretern der Gattung Phoneutria innerhalb der Familie der Kammspinnen (Ctenidae), die ebenfalls auf Bananenplantagen leben, gemein. Im Gegensatz zu letzteren, zu denen auch die giftige Brasilianische Wanderspinne (P. nigriventer) gehört, ist die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne für den Menschen weitestgehend ungefährlich.
Die nachtaktive Warmhaus-Riesenkrabbenspinne legt wie alle Angehörigen der Familie der Riesenkrabbenspinnen kein Spinnennetz zum Fangzweck an, sondern erlegt Beutetiere freilaufend als Lauerjäger. Wegen ihrer für Spinnen beachtlichen Dimensionen weist die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne ein vergleichsweise großes Beutespektrum auf, wozu auch größere und wehrhaftere Gliederfüßer sowie kleinere Wirbeltiere gehören. Eine weitere besondere Eigenschaft der Art ist die Fähigkeit des Männchens zur Lauterzeugung durch Reiben zweier Körperteile (Stridulation), die bei der Balz Anwendung findet.
Te
TerrestrischTerrestrische Tiere sind Tiere, die überwiegend oder vollständig an Land leben (z.B. Katzen, Ameisen, Schnecken), im Gegensatz zu aquatischen Tiere...
Ov
OviparieAls ovipar bezeichnet man Tiere, die Eier legen. Der Oviparie steht die Viviparie gegenüber. Die Vertreter beider Fortpflanzungsformen stellen kein...
H
beginnt mitDas Weibchen der Warmhaus-Riesenkrabbenspinne erreicht eine Körperlänge von 17 bis 34 Millimetern, das Männchen eine von bis zu 21 Millimetern. Ausgewachsene Exemplare der Art erreichen eine Beinspannweite von etwa 70 bis 120 Millimetern, was die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne zu einer vergleichsweise großen Spinne macht.
Der Körperbau der Art entspricht dem anderer Vertreter der Echten Riesenkrabbenspinnen (Heteropoda), womit auch die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne einen für Riesenkrabbenspinnen (Sparassidae) üblichen deutlich abgeflachten Habitus (äußere Erscheinung) aufweist. Ebenso gleicht die Beinanordnung der anderer Riesenkrabbenspinnen, d. h., das zweite Beinpaar ist deutlich länger. Beide Augenreihen sind nach hinten gebogen und die vorderen Mittelaugen sind kleiner als die vorderen Seitenaugen. Die hinteren Seitenaugen befinden sich auf leichten Erhebungen. Ähnlich wie bei Wolfsspinnen (Lycosidae) sind auch gut getarnte Individuen der Warmhaus-Riesenkrabbenspinne in der Nacht mit einer geeigneten Lichtquelle, z. B. einer Taschenlampe, durch die reflektierenden Augen leicht auffindbar.
Die Grundfärbung der Warmhaus-Riesenkrabbenspinne ist braun. Beide Geschlechter verfügen über einen gelb- bis cremefarbenen Clypeus (Bereich zw. Augen und Cheliceren bzw. Kieferklauen) und ein breites Randband, das den Carapax (Rückenschild des Prosomas bzw. Vorderkörpers) umgibt, der bei beiden Geschlechtern unterschiedlich gefärbt ist. Dazu haben sowohl das Männchen als auch das Weibchen schwarze Flecken auf den Beinen, aus denen eine auffällige und kurz ausfallende Behaarung entspringt.
Das Weibchen der Warmhaus-Riesenkrabbenspinne ist wesentlich kräftiger gebaut und hat im Verhältnis kürzere Beine als das Männchen. Dabei tritt insbesondere das Opisthosoma (Hinterleib) deutlich kräftiger als beim Männchen in Erscheinung. Das Randband auf dem Carapax ist beim Weibchen dunkelgelb gefärbt. Ansonsten ist das Weibchen verglichen mit dem Männchen kontrastarm gezeichnet.
Das weniger kräftig gebaute Männchen hat längere Beine als das weibliche Gegenstück. Hier tritt das Randband des Carapaxes cremefarben in Erscheinung. Das Männchen verfügt im Gegensatz zu dem Weibchen zusätzlich über ein dunkles Längsband auf dem Opisthosoma und einen hell umrandeten und blassen Bereich hinter den Augen.
Ein Vorläufer der Cystein-reichen Peptide in voller Länge enthält je eine Signalsequenz und ein reifes Peptid, während einige Vorläufer der Cystein-reichen Peptide zusätzlich ein Präkursor-Protein vor der reifen Toxinsequenz enthalten, was auch auf Vorläufer der überwiegenden Mehrheit der zuvor berichteten Peptide der Spinnentoxine zutrifft. Die Ausrichtung der resultierenden Aminosäuresequenzen ergab für die meisten auftretenden Formen der Cystein-reichen Peptiden eine weitgehende Variation der Molekülstruktur von den Transkripten.





Die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne war ursprünglich vermutlich in Südostasien beheimatet und wurde in vielen Teilen der Welt, darunter Europa, Afrika, Amerika, den pazifischen Inseln und Makaronesien eingeführt. In Gebieten, die der Art in freier Natur bedingt durch jahreszeitliche Schwankungen kein Überleben ermöglichen, darunter Zentraleuropa, kommt sie synanthrop (an menschliche Siedlungsbereiche gebunden) vor.
Über die bevorzugten Habitate (Lebensräume) der Warmhaus-Riesenkrabbenspinne in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet liegen keine genaueren Informationen vor. In klimatisch ungünstigen Gebieten ist die dort eingeschleppte Art besonders in beheizten Einrichtungen, darunter vor allem Gewächshäusern und geheizten Lagerhäusern, vorfindbar. Aus dem US-Staat Florida liegen allerdings auch Berichte über eine Anpassung außerhalb menschlicher Behausungen vor, wo die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne insbesondere Avocado-Haine bewohnt.

Die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne ist vornehmlich nachtaktiv. Tagsüber hält sie sich in temporären Unterschlüpfen verborgen. Bedingt durch den abgeflachten Körperbau der Spinne können dies auch schmale Ritzen sein.
Die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne lebt wie nahezu alle Spinnen ausschließlich räuberisch, jagt wie andere Riesenkrabbenspinnen (Sparassidae) ohne Fangnetz und erlegt Beutetiere demzufolge freilaufend. Wie alle Riesenkrabbenspinnen erreicht sie dabei hohe Laufgeschwindigkeiten.
Das Gift der Warmhaus-Riesenkrabbenspinne besteht aus niedermolekularen Substanzen und Salzen sowie aus Peptiden und Proteinen. Letztere wirken teilweise als Spinnentoxine, deren Beschaffenheit und Wirkung mithilfe der Toxikologie erforscht wird.
Das Gift der Warmhaus-Riesenkrabbenspinne wird als klare, farblose Flüssigkeit, die sich leicht in Wasser lösen lässt, beschrieben. Es wirkt tödlich auf Küchenschaben mit einem LD50-Wert von 28,18 μg/g. Seine Dichte beträgt 978 mg/ml, der Proteingehalt beträgt etwa 32 %. Unter den Proteinen finden sich über 100 Peptide, von denen der Großteil in einem Molekulargewichtsbereich von 3000 bis 5000 Da liegt, was 27 bis 40 Aminosäuren entspricht. In diesem Gewichtsbereich befinden sich auch die drei Heteropodatoxine (HpTx) sowie das Insektizid μ-Sparatoxin-Hv2. Anhand der Peptidsequenz und der Position der Cystein-Einheiten können 154 Peptid-Präkursoren aus dem Spinnengift in 24 Familien unterteilt werden.
Die Heteropodatoxine sind Inhibitoren für spannungsaktivierte Kaliumkanäle mit Massen von 3,4 kDa bis 4 kDa. Sie bestehen aus 30–33 Aminosäuren mit amidiertem C-Terminus und weisen ein Sequenzidentität von 39–41 % untereinander auf. Dabei sind die sechs die Tertiärstruktur bestimmenden Cystein-Einheiten in ähnlichen Positionen und bilden drei Disulfid-Brücken aus. Außerdem weist das HpTx3 mit 39 % eine hohe Gemeinsamkeit mit dem in Grammostola rosea vorkommenden Hanatoxin 2 (HaTx2) auf. Die HpTx blocken die Kv4.2-Kanäle spannungsabhängig, was zu einem verlängerten Aktionspotential führt.
Das μ-Sparatoxin-Hv2 wirkt hauptsächlich insektizid. Auf die Navs-Kanäle von Küchenschabenzellen wirkt das Toxin mit einem IC50 von 6,25 μg/ml bzw. 833,7 nM, während es keinen Effekt auf Kalium- und Calciumkanäle hat. Auf Rattenzellen hat das Toxin eine schwächere Wirkung und blockiert die Kanäle nur partiell, während es auf Mäuse bei einer Dosis von 7,0 μg/g keine Wirkung zeigt.
Die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne ist ein opportunistischer Jäger und erlegt demzufolge alle Beutetiere, die die Spinne zu überwältigen vermag. Am häufigsten werden andere Gliederfüßer erbeutet. Unter 2013 geschehenen Versuchen wurde erwiesen, dass die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne eine Vielzahl von Insekten wie Schaben, Grashüpfer, Stubenfliegen, Mücken, Läuse, Libellen und Marienkäfer als Beute annimmt. Lediglich kleinere Individuen der Art mit einer Körperlänge von bis zu 15 Millimetern erbeuteten Fliegen, Mücken und Läuse, die von den größeren Spinnen zumeist ignoriert wurden. Ameisen wurden in der Versuchsreihe gänzlich gemieden. Auch andere Spinnen wie Echte Radnetzspinnen (Araneidae) aus den Gattungen der Riedkreuzspinnen (Neoscona) und der Südlichen Radnetzspinnen (Argiope), Zitterspinnen (Pholcidae) aus der Gattung der Moskito- (Crossopriza) und der Echten Zitterspinnen (Pholcus), Springspinnen (Salticidae) aus der Gattung Plexippus und Kugelspinnen (Theridiidae) aus der Gattung der Echten Kugelspinnen (Theridion) nahmen die Exemplare der Warmhaus-Riesenkrabbenspinne unter Laborbedingungen als Beute an. Hierbei erwiesen sich jedoch insbesondere Schaben und an zweiter Stelle Moskito-Zitterspinnen als bevorzugte Beute der Warmhaus-Riesenkrabbenspinne.
Die Art wurde auch dabei beobachtet, wehrhafte Beutetiere wie Skorpione oder kleine Wirbeltiere wie Fledermäuse zu überwältigen. 2017 wurde ein Weibchen der Warmhaus-Riesenkrabbenspinne dabei beobachtet, ein Exemplar des ebenfalls an menschliche Siedlungsbereiche angepassten Asiatischen Hausgecko (Hemidactylus frenatus) zu verzehren, das es zum Zeitpunkt der Sichtung bereits überwältigt und schon zur Hälfte ausgesogen hatte. Die Spinne maß eine Körperlänge von 23 und eine Beinspannweite von 110 Millimetern. Der Fund geschah im Dorf Jaymoni im Distrikt Bagerhat im Südwesten von Bangladesch. Bei dem Fundort handelte es sich um eine hölzerne Säule.
Der Lebenszyklus der Warmhaus-Riesenkrabbenspinne ist wie bei anderen Spinnen in mehrere Abschnitte unterteilt. Das Fortpflanzungsverhalten und das Heranwachsen der Jungtiere wurde besonders in Gefangenschaft dokumentiert.
Die Phänologie (Aktivitätszeit) der Warmhaus-Riesenkrabbenspinne umfasst das ganze Jahr. Gleiches trifft auch auf die Entwicklungszeit zu, sodass ausgewachsene Exemplare und Jungtiere simultan zu jeder Jahreszeit angetroffen werden können. Auch die Paarungszeit ist bei der Art nicht auf eine zeitliche Periode beschränkt.
Wurde ein Weibchen gefunden, beginnt das Männchen mit seinem bemerkenswerten Balzverhalten, das neben optischen Signalen zusammen mit dem weniger anderer Spinnen, darunter der Fettspinne (Steatoda bipunctata) oder einiger Spring- (Salticidae) oder Vogelspinnen (Theraphosidae), mitunter Stridulationen (Lauterzeugung durch Reiben zweier Körperteile) enthält. Zuerst nähert sich das Männchen allerdings vorsichtig dem Weibchen und hält dabei sein erstes Beinpaar angehoben nach vorne gestreckt. Dann reibt es diese Beine auf jeder Seite aneinander, während das Weibchen unbeweglich verbleibt.
Sollte das Weibchen paarungswillig sein und demzufolge auch eine Paarung erfolgen, trommelt das Männchen mit seinen Pedipalpen auf den Untergrund und führt vibrierende Bewegungen aus, ehe es langsam das Weibchen frontal besteigt. Beide Geschlechtspartner nehmen dadurch die für Echte Webspinnen, die ohne Fangnetz jagen, typische Position ein, bei der sie in die jeweils entgegengesetzte Richtung blicken. Unmittelbar vor der Paarung umschließt das Männchen mit den beiden hinteren Beinpaaren das Prosoma des Weibchens.
Die eigentliche Paarung kann bis zu sechs Stunden dauern und das Männchen streicht bei der erstmaligen Einfuhr eines Bulbus die Ventralseite des Weibchens mit seinen Pedipalpen. Während der Paarung wechselt das Männchen seine in die Spermathek des Weibchens einzuführenden Bulbi permanent in einem Abstand von durchschnittlich 20,4 Sekunden, maximal einer Minute. Dabei dauert auch eine einzelne Einführung des jeweiligen Bulbus sechs bis sieben Sekunden. Um dies zu erreichen, kippt das Männchen sein Prosoma entweder zur rechten oder zur linken Seite, hebt mit dem vorderen Beinpaar das Opisthosoma seiner Partnerin, sodass die Einfuhr mit dem jeweils auf der gekippten Seite liegenden Bulbus erfolgen kann.
Nach der Paarung befreit sich oft das zumeist erschöpfte Weibchen gewaltsam vom Griff des Männchens und es kommt nicht selten zu Kannibalismus seitens des Weibchens gegenüber seinem Geschlechtspartner. Die meist höhere Fundrate von weiblichen Individuen der Warmhaus-Riesenkrabbenspinne gegenüber männlichen könnte so erklärt werden.
Nach der Fertigung des Kokons drückt das Weibchen diesen für etwa zwei Minuten unter sich an sein Opisthosoma, ehe es den Kokon mit Hilfe seiner Pedipalpen vom Untergrund trennt. Der Kokon wird von dem Weibchen während der gesamten Inkubationszeit mit Hilfe der Cheliceren und der Pedipalpen nahe am Sternum (Brustschild des Prosomas) gehalten. Der anfangs helle Kokon verdunkelt sich allmählich und schrumpft überdies im Laufe der Zeit leicht. Das Weibchen trägt den Kokon bis zum Schlupf, der etwa 30 Tage nach der Eiablage erfolgt, ununterbrochen mit sich herum und nimmt in dieser Zeit keine Nahrung zu sich. Aufgrund dessen kann auch der Hungertod des Weibchens daraus resultieren oder der Kokon wird vom Weibchen aufgefressen. Kokons mit unbefruchteten Eiern werden von ihren Herstellern fallen gelassen oder ebenfalls verzehrt. In diesem Fall wird die Inkubation unterbrochen und somit auch ein Schlupf der Jungtiere ohne Weiteres verhindert.
Ein begattetes Weibchen kann nacheinander maximal drei Kokons produzieren. Mit zunehmender Anzahl der von einem Weibchen angelegten Kokons wird die Schlupfrate allerdings geringer und kann unter einem Drittel der Maximalschlupfrate des ersten Kokons herabfallen. Das zeitliche Intervall der nacheinander folgenden Eikokons liegt bei etwa 50 bis 60 Tagen. Ferner ist möglich, einem Weibchen der Warmhaus-Riesenkrabbenspinne einen zuvor von einem anderen gefertigten Kokon zu geben, der von diesem dann angenommen und wie der eigene behandelt wird. In diesem Falle findet auch ein Schlupf der Jungtiere nach einer erfolgreichen abgeschlossenen Inkubation statt.

Die globalen Bestände der Warmhaus-Riesenkrabbenspinne werden von der IUCN nicht erfasst. Demzufolge gibt es keine Angaben über potentielle Gefährdungen der Art und sie unterliegt auch keinem Schutz.
Auch in der Roten Liste gefährdeter Arten Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands bzw. der Roten Liste und Gesamtartenliste der Spinnen Deutschlands (2016) wird die Art nicht bewertet, da die Warmhaus-Riesenkrabbenspinne in Deutschland nicht heimisch ist und ohnehin nur in beheizten Einrichtungen vorkommt. Hier gilt die Art als sehr selten und ihre Bestände nehmen langfristig zu.